Markus Brechtken - Aufarbeitung des Nationalsozialismus: Ein Kompendium
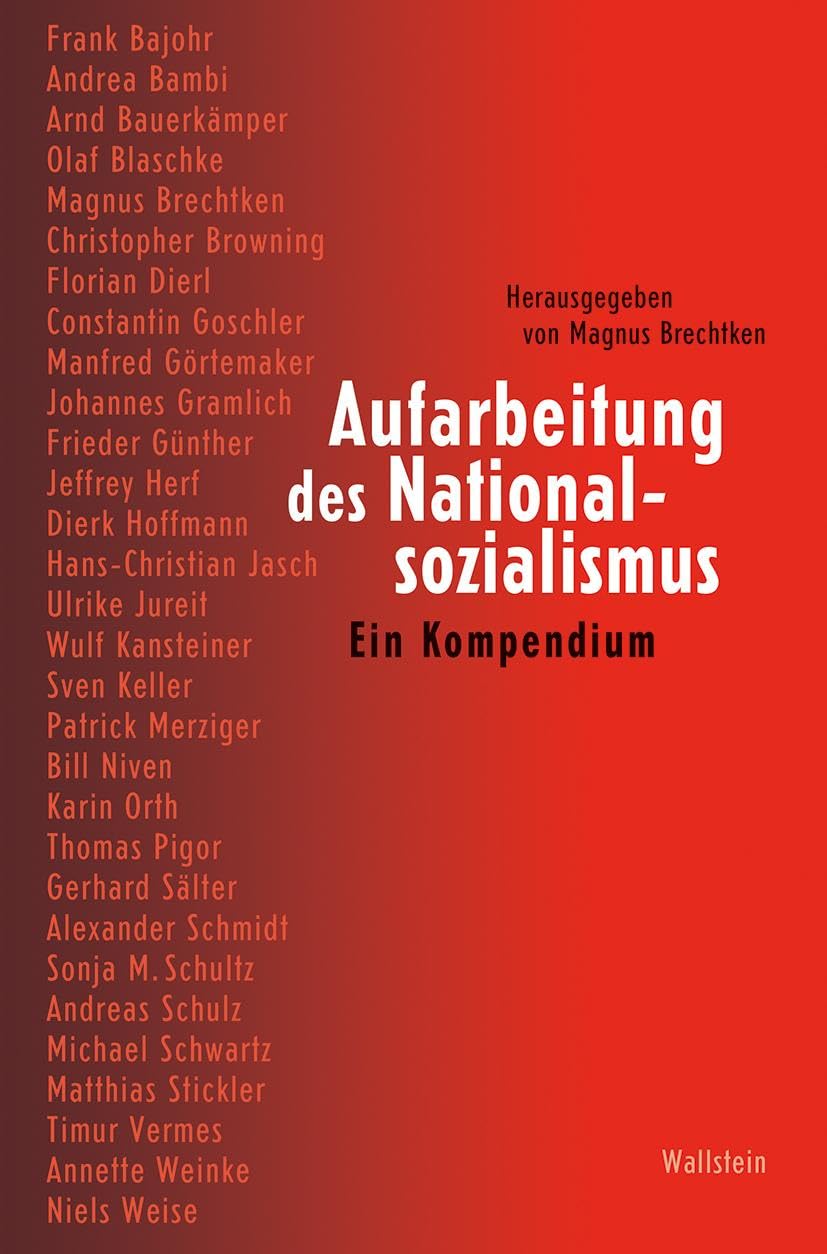 Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist, wie bereits in Magnus Brechtkens Einleitung deutlich gesagt wird, ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Die jüngsten Debatten um die Vergleichbarkeit des Holocaust etwa mit den Kolonialverbrechen oder die Forderung nach einem Schlussstrich und einem Ende der Aufarbeitung weisen von zwei Enden des politischen Spektrums auf die weiterhin bestehende Relevanz des Themas hin, die durch stets weitere historische Forschungsarbeit wie etwa die Auftragsarbeiten der Behörden (die, ihrerseits nicht unproblematisch, im Buch beleuchtet werden) untermauert wird. Doch nicht nur neue Erkenntnisse sollen im Zentrum des Bands stehen, sondern die Frage, wie der Holocaust rezipiert wird, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. Zu diesem Zweck versammelt das "Kompendium" zahlreiche Aufsätze von Fachwissenschaftler*innen. So leitet Brechtken in den ersten Abschnitt, "Einführende Perspektiven", ein.
Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist, wie bereits in Magnus Brechtkens Einleitung deutlich gesagt wird, ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Die jüngsten Debatten um die Vergleichbarkeit des Holocaust etwa mit den Kolonialverbrechen oder die Forderung nach einem Schlussstrich und einem Ende der Aufarbeitung weisen von zwei Enden des politischen Spektrums auf die weiterhin bestehende Relevanz des Themas hin, die durch stets weitere historische Forschungsarbeit wie etwa die Auftragsarbeiten der Behörden (die, ihrerseits nicht unproblematisch, im Buch beleuchtet werden) untermauert wird. Doch nicht nur neue Erkenntnisse sollen im Zentrum des Bands stehen, sondern die Frage, wie der Holocaust rezipiert wird, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. Zu diesem Zweck versammelt das "Kompendium" zahlreiche Aufsätze von Fachwissenschaftler*innen. So leitet Brechtken in den ersten Abschnitt, "Einführende Perspektiven", ein.
Im von Arnt Bauerkämpfer verfassten ersten Kapitel, "Transnationale Perspektiven der Aufarbeitung", legt der Autor dar, wie die deutsche Art der Aufarbeitung in anderen Ländern rezipiert wurde. Seine zentrale These ist, dass die deutsche Aufarbeitung ein Phänomen sui generis sei und nur bedingt als Vorbild tauge. Es bestehe die Gefahr, "Sühnestolz" zu entwickeln; zudem werde die deutsche Art gerne als Waffe für innen- und außenpolitische Konflikte gebraucht, etwa in Japan, wo sowohl die progressive Opposition als auch China versuchen, die konservative Leugnungspolitik anzugreifen, wenngleich aus unterschiedlichen Motiven.
Von Jeffrey Herf stammt das zweite Kapitel, "Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Deutschland seit 1945. Anfänge, Hauptmotive und Kritik an der Erinnerungspolitik des SED-Regimes und der radikalen Linken in Deutschland", das nicht nur einen kurzen Überblick in die sattsam bekannte Geschichte der westdeutschen Aufarbeitung von der Adenauer'schen Schlussstrichpolitik über die verschiedenen Prozesse und Willy Brandts Kniefall zu der Serie Holocaust und dem Historikerstreit zieht, sondern vor allem die DDR in den Blick nimmt. Herf arbeitet die außenpolitische Lage heraus, in der die DDR die sowjetische Politik der Unterstützung der arabischen Staaten enthusiastisch nachvollzog, und kombiniert diese mit der ideologischen Grundhaltung, den Faschismus durch die Zerstörung des Kapitalismus überwunden zu haben, den man weiterhin jüdisch dominiert sah, weswegen im Namen der Holocaust-Überwindung der bewaffnete Kampf gegen Israel keinen Widerspruch darstellte. Dieser aggressive Antisemitismus übertrug sich auch auf die westdeutsche radikale Linke, die spätestens ab den 1960er Jahren die Unterstützung der Israelfeinde aggressiv propagierte, mit dem blutigen Höhepunkt der Zusammenarbeit des RAF-Terrors mit dem der PLO.
Von Magnus Brechtken stammt dann wieder das dritte Kapitel, "Die Gründungswege des Instituts für Zeitgeschichte - eine Aktualisierung", das quasi eine geschichtswissenschaftliche Nabelschau betreibt und nachzeichnet, wie das Institut für Zeitgeschichte 1950 konkret für die Aufarbeitung gegen den Widerstand konservativer Historiker gegründet wurde. Besonders hervorzuheben ist hier Gerhard Ritter, der in dieser Zeit ja auch ein großer Gegner Fritz Fischers war und versuchte, die Schuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg zu rehabilitieren. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar blockierte die Geschichtswissenschaft damals - und noch bis in die 1970er Jahre - die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, weswegen das Institut für Zeitgeschichte auch bei den Politologen unterkam.
Der zweite Abschnitt, "Verfolgung und Holocaust", beschäftigt sich mit der gegenständlichen historischen Forschung zum Thema.
Den Anfang macht in Kapitel 4, "Geschichte und Struktur des nationalsozialistischen KZ-Systems", Karin Orth, die nachzeichnet, wie die KZs sich vor allem ab 1936 planmäßig aus den "wilden Lagern" der Anfangszeit entwickelten und besonders von Himmler von der Justiz und Polizei abgeschottet wurden, um so einen eigenen bewaffneten Wachverband aufbauen zu können und die Lager dem normalen Strafvollzug komplett zu entfernen. Mit Kriegsbeginn eskalierte die Lagerstruktur dann; immer mehr Lager wurden erst an den Außengrenzen zur Sicherung, dann zur Verwahrung von verfolgten Zivilist*innen und Kriegsgefangenen aufgebaut. Hier begann dann auch das massenhafte Sterben; immer mehr Menschen in den Lagern waren Nicht-Deutsche. Auch die rassische Winkel-Einteilung begann hier. Ab 1941 folgte dann der Ausbau in Vernichtungslager; ab 1942 wurden die Häftlinge vermehrt (und reichlich ineffizient) für den Arbeitseinsatz herangezogen. In der Endphase des Krieges wurden die Lager aufgelöst und die Häftlinge auf Todesmärsche geschickt. Ich fand es instruktiv, wie viele Häftlinge auf diesen Todesmärschen umkamen - ein erklecklicher Anteil der insgesamt im Holocaust Ermordeten - und wie die Lagerstruktur dem üblichen Verlauf der NS-Institutionen folgte, mit einer Aufblähung des Apparats, die seine eigentlichen Ziele ad absurdum führte (der SS entglitt ab 1944 die Kontrolle über die Lager) und ein Ende in absolutem Chaos.
Die Entwicklung der Forschung am Gegenstand wird von Frank Bajohr in Kapitel 5, "Holocaustforschung - Entwicklungslinien in Deutschland seit 1945", aufgezeigt. Erst 1979, unter dem Eindruck der Fernsehserie "Holocaust", äußerte sich mit Martin Broszat ein prominenter deutscher Historiker, ohne jedoch die Holocaustforschung, die bis in die 1990er Jahre hinein ein merkwürdig vom internationalen Forschungsstand abgeschottetes Dasein fristete, damit auf einen angemessenen Stand bringen zu können. Vorherige Versuche waren weitgehend am Widerstand der historischen Zunft gescheitert. Interessanterweise war es die Rechtswissenschaft, die in den 1960er Jahren durch die Prozessvorbereitungen und die Arbeit in Ludwigsburg einen wesentlich besseren Kenntnisstand hatte als die Geschichtswissenschaft, die, in der veralteten Totalitarismustheorie gefangen, nicht in der Lage war, den Holocaust als singuläres, von der Endlösung getrenntes Phänomen zu betrachten. Das schlimmste Jahrzehnt aber waren die 1970er, in denen ein "zweites Verdrängen" stattfand - und praktisch keinerlei Holocaustforschung. Das änderte sich in den 1980er Jahren, bevor in den 1990er Jahren ein wahrer Boom der Holocaustforschung stattfand, der auch mit der Öffnung der Archive in Osteuropa und einer neuen Forschendengeneration zu tun hatte und zu einer Ausdifferenzierung der Positionen führte.
Das sechste Kapitel von Christopher Browning, "Die Entwicklung der Holocaustforschung. Eine amerikanische Perspektive", zeichnet die Entwicklung mit einer eigenen Schwerpunktsetzung noch einmal nach. Der Titel ist etwas irreführend, als dass es eher eine persönliche Perspektive Brownings als eine spezifisch amerikanische ist (im engen Sinne natürlich korrekt, aber...). Aber das ändert nichts daran, dass der Aufsatz ein guter Begleiter für den vorherigen ist und die internationale Forschung etwas mehr in den Blick nimmt. Browning betont besonders die Konflikte innerhalb der Forschung, wie etwa den Institutionalismus im Rahmen des Eichmann-Prozesses (Arendt fiel auch Eichmann herein) oder den Streit in den 1980er Jahren, der letztlich sehr technisch blieb und erst in den 1990er Jahren durch Forschung auf der Mikroebene ergänzt wurde, die individuelle Täter- und Opfergeschichten auch lokal in den Blick nahm und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Erinnerungspolitik leistete.
Ulrike Jureit spricht in Kapitel 7, "Womit wir alle nicht fertig werden. Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust", über die Schwierigkeit des Erinnerungsbegriffs. Mithilfe soziologischer Erinnerungstheorien stellt sie die Frage, ob es so etwas wie eine Erinnerungskultur überhaupt geben kann, weil dies ein kollektives Gedächtnis voraussetze, das nicht existiere. Stattdessen plädiert sie für den Begriff der Vergegenwärtigung. Sie zeichnet zudem die Linien der Diskussion um die Erinnerungskultur und ihre wechselnden moralischen Imperative nach, etwa die zunehmende Sinnlosigkeit von Schlagworten wie "Nie wieder!", die mit dem Aussterben sowohl der Täter*innengeneration als auch ihrer Kinder keinen Bezug zu denen aufweist, die hier etwas erinnern sollen, das sie nicht erinnern können, und erkennt stattdessen neue moralische Imperative in der Vergegenwärtigungskultur unserer Zeit.
Abschnitt 3 kümmert sich um "Juristische Dimensionen".
Den Anfang macht Anette Weinke in Kapitel 8, "Von der (Vor-)Ermittlungsbehörde zur "neuen Täterforschung". Die Zentrale Stelle in Ludwigsburg", in der sie zuerst die Entstehungsgeschichte des Instituts nachzeichnet. In den frühen 1950er Jahren versuchte die BRD unter Adenauer, die Aufarbeitung zu beenden und die Deutschen als "Kriegs- und Gewaltherrschaftsopfer" mit allen anderen Opfern in einen Topf zu werfen. Während die Strafverfolgung keine Ressourcen erhielt, wurden großzügige Bundesmittel bereitgestellt, um NS-Tätern rechtlichen Beistand zu gewähren, und zahlreiche Amnesiegesetze erlassen. Die Einrichtung der Zentralstelle war demgegenüber ein Fortschritt, aber mit spezifisch deutschen Prärogativen verbunden. Die rechtliche Ausgestaltung der Verfolgung, besonders ihre starke Einengung auf klare "exzessive Morde", bedeutete von Beginn an eine geringe Zahl von Verurteilungen; erst das Demjanjuk-Urteil 2011 würde das, reichlich spät, ändern. Gleichzeitig aber ist Ludwigsburg für die Forschung eine unbezahlbare, wenngleich juristisch gefärbte, Quelle. Wie bei so vielem bleibt die Bilanz daher ambivalent.
Etwas theoretischer wird Hans-Christian Jasch in Kapitel 9, "NS-Verbrechen vor bundesdeutschen Gerichten. Zu Täterschaft und Täterbegriff". Er beginnt seine Darstellung mit der Rolle des Besatzungsrechts, nach dem die ersten Prozesse abliefen, das die deutschen Behörden aber hintertrieben und ablehnten. Für die deutschen Juristen bestand das zentrale Problem darin, dass sie rückwirkende Verurteilungen ebenso ablehnten wie einen Täterbegriff, der sich nicht ausschließlich auf konkret nachweisbare Mordakte bezog - was freilich die Verfolgung von Tätern beinahe verunmöglichte. Zudem wurde eine Reihe von Amnesiegesetzen verabschiedet, die durch Gesetze, die die Strafverfolgung de facto erschwerten (wie eines, das die Mitgliedschaft in NS-Organisationen aus den Registern löschte). Zudem verunmöglichte das Bestehen der deutschen Justiz darauf, nur konkret nachgewiesene "exzessive" Morde sühnen zu wollen, die Verfolgung. Erschwerend hinzu kam, dass sie die Überzeugung vertrat, dass bis auf wenige Haupttäter (die bequemerweise alle tot waren) niemand die Wahl hatte und somit wegen Mordes nicht belangt werden konnte. Entsprechend dürftig blieb der Täterbegriff definiert - und damit die Bilanz.
Abschnitt 4, "Historische Orte und Erinnerungspolitik", befasst sich mit den Orten, an denen das historische Wirken der Nazis besonders konzentriert auftrat, und wie sie für die Erinnerungspolitik genutzt werden.
Den Anfang macht Florian Dierl in Kapitel 10, "Gedenkstätte, Dokumentationszentren und Museen als Akteure der Vergangenheitsaufarbeitung", in dem er einerseits aufzeigt, wie an den Orten des Verbrechens Gedenkstätten entstanden (wenn sie nicht in einem großen Versuch des baulichen Vergessens direkt anderer Nutzung zugeführt wurden) und Museen versuchten, ihren Teil zur Bildung der Bevölkerung beizutragen. Dierl legt dabei besonderes Gewicht auf das Problem, den Spagat zwischen Erinnerungstourismus und genuinem Bildungsauftrag zu gewährleisten, denn die steigende Erinnerungskultur ab den 1980er/1990er Jahren entwickelte sich für die entsprechenden Orte von der Wahrnehmung des "Schandflecks" zu einem wichtigen touristischen Faktor.
Ein Beispiel dafür untersucht Alexander Schmidt in Kapitel 11, ""Nürnberg" - vom Stigma der besonders belasteten Stadt zum Imagefaktor Erinnerungskultur". Als Stadt der Reichsparteitage und Schauplatz der Nürnberger Prozesse sahen sich die Stadt und das Land Bayern gleich zweifach belastet und imagegeschädigt und versuchten in den 1950er Jahren, möglichst viel von den Hinterlassenschaften zu zerstören oder kommerziell umzuwidmen (Quelle etwa mietete Teile der ehemaligen NS-Kongresshalle als Lager). Erst in den 1970er Jahren wurde die Umwidmung des Zeppelinfelds zu einem Ort von anderen Veranstaltungen und so ein Bruch mit der Erinnerung entstand. Inzwischen ist die Erinnerung an beide Hinterlassenschaften ein wichtiger und stolz präsentierter Wirtschaftsfaktor, der soweit geht, mit über 80 Millionen Euro die Bausubstanz des Zeppelinfelds zu erhalten - obwohl Historiker*innen davor warnen, dass hier vor allem kitschiger Erinnerungstourismus und weniger Bildung betrieben werde.
Noch krasser sieht das für den von Sven Keller in Kapitel 12, "Er bleibt - aber wie? Der Obersalzberg als Hitler-Ort", Obersalzberg aus. Bereits in den späten 1940er Jahren war Hitlers Ferienort ein attraktives Ausflugsziel, vor allem für die Amerikaner, die hier quasi symbolisch Hitler noch einmal töteten, aber auch zunehmend für die Deutschen, die mit einem kitschigen und nahtlos an NS-Propaganda anknüpfendem Hitler-Kitsch versorgt wurden. In den 1960er Jahren nahm Kritik daran zu, aber die örtliche CSU versuchte, die Entpolitisierung des Obersalzbergs und den Führer-und-Eva-Kitsch weiter als Wirtschaftsfaktor zu erhalten, was auch sehr gut gelang.
Abschnitt 5, "Funktionäre und politische Akteure", betrachtet vor allem die eher umstrittenen Akteure in der Vergangenheitsbewältigung; etwas merkwürdig, dass auf die konstruktiv wirkenden Akteure hier kein Blick fällt.
Matthias Stickler macht in Kapitel 13 "Die deutschen Vertriebenenverbände - historiographische Aspekte", den Anfang, indem er herausarbeitet, wie sich diese einerseits als unbelastet selbst inszenierten und sie gleichzeitig von der DDR-Forschung als Schreck- und Zerrbild gezeichnet wurden (vor allem ab 1982, aber bereits in den 1950er Jahren wurde der Einfluss der Vertriebenenverbände völlig übertrieben), was vor allem deswegen so gut gelang, weil in der Bundesrepublik eine kritische Sichtweise kaum Platz hatte und die Erforschung fehlte. Ein Überblick über die Forschungsgeschichte zu den Verbänden schließt das Kapitel ab.
Diese Thematik wird von Michael Schwarz in Kapitel 14, "Vertriebenenpolitiker in der Bundesrepublik Deutschland. NS-Vergangenheiten und politisches Engagement in der Demokratie", weiter ausgebaut. Schwarz greift sich einige BdV-Funktionärsbiographien und untersucht anhand von diesen, inwieweit Kontinuitäten zur NS-Ideologie bestanden. Er kann dabei aufzeigen, dass die Verbände zwar eine grundsätzlich national gesinnte und revisionistisch orientierte Linie verfolgten und zu großen Teilen auch völkisch bestimmt blieben, das Bild aber insgesamt differenziert ist und die Breite der Themen - vor allem solchen wie dem sozialen Wohnungsbau - und die Haltung der Funktionäre Anknüpfungspunkte bis tief in die SPD erlaubte, so dass die Verbände bis 1969 und dem Bruch mit der SPD durchaus einen überparteilichen Anspruch behalten konnten. Gleichzeitig war manches Personal wie der baden-württembergische Landesvorsitzende Schmocker so offensichtlich NS-belastet, dass sie von einer Allparteienkoalition an einem Eintritt in die Landesregierung gehindert wurden, bis ein geändertes politisches Umfeld in den 1970er Jahren zu einer vollständigen politischen Integration in die CDU führte. Schwarz beschreibt auch, dass die BdV-Vorsitzenden sich mit dem Argument legitimierten, ihre Mitglieder wenigstens politisch aus den extremen Parteien herauszuhalten und deswegen mit der CDU kooperierten und nicht etwa mit der NPD (auch wenn Einzelmitglieder hier durchaus Sympathien besaßen und kooperierten).
Ein anderes Feld untersucht Andreas Schulz in Kapitel 15, "Braune Parlamentarier? Zur NS-Vergangenheit des Deutschen Bundestags". Seine Fragestellung ist vor allem, ob "braune Seilschaften" existierten. Dies ist erstaunlich schwierig zu sagen, weil die Biografien der frühen Bundestage noch nicht durchgehend erforscht sind und die verfügbaren Daten auf Selbstauskünften beruhen und deswegen unzuverlässig sind. Er postuliert aber klar, dass die Abgeordneten zwar allesamt eine Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit verhinderten und nach Ende der alliierten Aufsicht auch früheren NS-Funktionären den Weg in den Bundestag ebneten, gleichzeitig aber eine Läuterung der Betroffenen und Integration in den Parlamentarismus stattgefunden habe und NS-Gedankengut keinen Platz hatte.
Abschnitt 6, "Behörden und Auftragsforschung", befasst sich mit der von Joschka Fischers Außenministerium ausgelösten Welle von behördlicher Auftragsforschung, in denen die Behörden ihre Vergangenheit aufarbeiten ließen.
Den Anfang macht Niels Weise in Kapitel 16, ""Mehr als Nazizählerei". Die Konjunktur der behördlichen Aufarbeitungsforschung seit 2005", in dem er beschreibt, wie ausgehend von der Studie des Auswärtigen Amts (die unter dem Titel "Das Amt" zu einem relativen Bestseller wurde und viel Aufmerksamkeit auf sich zog) nach und nach fast sämtliche Bundesbehörden ihre Vergangenheit untersuchen ließen. Der Umfang und die Zielrichtung der Arbeiten waren dabei jeweils verschieden, weswegen die Ergebnisse nicht zu hundert Prozent vergleichbar sind - das erfordert Meta-Forschung in der Zukunft -, aber der Vorwurf der "Nazizählerei" wird von Weise klar zurückgewiesen. Die Projekte seien unabhängig und wissenschaftlich sauber gewesen und hätten zahlreiche Erkenntnisse erbracht.
Constantin Goschler vertieft dies in Kapitel 17, "Auftragsforscher im Herzen der Finsternis? Das Geschichtsprojekt zum Bundesamt für Verfassungsschutz im Kontext der jüngeren Aufarbeitungsforschung", am Beispiel des Verfassungsschutzes. Ironischerweise sei diese Auftragsforschung die bis dato transparenteste gewesen, was zu starker Kritik geführt habe: gerade weil sie transparent war, habe man die Vergabeprozesse überhaupt kritisieren können. Das Ergebnis habe für sich gesprochen, weil der Verfassungsschutz nicht in die Arbeit eingegriffen und weitgehenden Zugriff gewährt habe, der seither schrittweise auch den Archiven zugänglich gemacht werde. Gleichzeitig betont Goschler immer wieder das Spannungsfeld der Geheimhaltungsnotwendigkeit und der offenen Forschung.
Einen anderen Schwerpunkt verfolgt Gerhard Sälter in Kapitel 18, "Professionalität, NS-Belastung und Integration der Staatsbediensteten: Über die Argumentationsfigur des Experten", in dem er sich der Argumentationsfigur der Behörden annimmt, man habe nach dem Krieg Experten gebraucht und deswegen abwägen müssen, ob die Belastung erträglich sei. Er stellt heraus, dass "Expertise" ein Begriff sei, der nicht so klar definiert sei, wie man das vielleicht annehmen könnte, weil etwa das frühe BKA die Mitarbeit in den Terrorschwadronen der sogenannten "Bandenbekämpfung" in Osteuropa als wichtige "Expertise" im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ansah und in Leuten, deren Karriere 1934 begonnen hatte, "Beamte alten Schlages" erkannte. Sälter arbeitet überzeugend heraus, dass in vielen Behörden nicht Altnazis trotz, sondern gerade wegen ihrer Belastung eingestellt wurden, weil diese einfach als Expertise umdefiniert wurde. Er stellt als Desiderat für zukünftige Forschung eine Vergleichsstudie zur DDR in den Raum, die wesentlich stärker die Funktionseliten auswechselte. Nur eine solche könnte zeigen, ob das Argument, dass man die Expertise gebraucht habe, zutrifft. Unabhängig davon beschreibt er die Integration dieser Menschen in die Demokratie insofern gelungen, als dass sie nicht aktiv gegen die Demokratie arbeiteten, macht aber deutlich, dass sie auch deswegen so gut funktionierte, weil sie ihre Ideologie und Arbeitsweisen in die BRD hinüberretten konnten.
Eine weitere Fallstudie bietet Manfred Görtemaker in Kapitel 19, "Die aktuelle geschichtspolitische Debatte und die Kommission des Bundesministeriums der Justiz", anhand des Justizministeriums. Während die Rolle der Juristen im Dritten Reich gut erforscht sei, treffe dies für das Ministerium selbst bisher nicht zu, weswegen die Studien relevant seien. Auch hier zeigt sich deutlich die Rolle der scheinbaren Expertise, die durch den Mythos des "unpolitischen Beamten" - ein Oxymoron vor dem Herrn.
In die vergleichende Forschung geht Frieder Günther in Kapitel 20, "Zweierlei Kontinuititäten. Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus". Wie der Titel bereits verrät untersucht er einerseits das westdeutsche BMI und andererseits das ostdeutsche MdI. Die Studie ist sehr fruchtbar, weil sie Unterschiede zwischen der Entwicklung in beiden deutschen Staaten exemplarisch herausarbeitet. Das Bundesinnenministerium wies eine hohe Kontinuität zu alten Nazis und ihren Methoden auf, verstand sich aber als demokratisches Ministerium insofern, als dass für das Personal zwar die Demokratie nicht begrüßenswert, aber die beste verfügbare Alternative war. Im Osten dagegen war der Bruch mit den Nazis viel deutlicher, wesentlich weniger Personal wurde übernommen. Man verstand sich anders als das betont "zivile" BMI als ein "revolutionäres" Ministerium, mit Uniformen, militärischem Gruß und Traditionspflege der alten Straßenkämpfe.
Ebenfalls die DDR betrachtet Dierk Hoffmann in Kapitel 21, "NS-Schatten in der früheren DDR-Geschichte. Das Beispiel der staatlichen Planungskommission", in dem er die wirtschaftliche Bürokratie unter die Lupe nimmt. Mehr als in anderen Ministerien war das Wirtschaftsministerium auf Fachleute angewiesen und zog Fachpersonal aus dem Nationalsozialismus heran. Die Wirtschaftspolitik verstand sich auch wesentliche mehr als in der BRD in Kontinuität zu der der 1930er Jahre.
Abschnitt 7, "Medien-Perspektiven", betrachtet die mediale Aufarbeitung des Holocaust.
Den Anfang macht Olaf Blascke in Kapitel 22, "Endlich genug von Hitler oder bitte noch mehr? Verlage als vergangenheitspolitische Akteure", in dem er eine quantitative Untersuchung aller Bücher vornimmt, die sich mit dem Nationalsozialismus oder Hitler beschäftigen. Dabei kann er einige "Wellen" des öffentlichen Interesses identifizieren, die einigermaßen überraschend zeigen, dass etwa Boomphasen von Hitler-Biografien mit den Standardwerken von Joachim (Anfang der 1970er Jahre) und Ian Kershaw (2000) nicht begannen, sondern eher endeten: danach war für eine Weile nichts zu sagen. In letzter Zeit erschienen aber wieder neue Biografien, und Hitler erscheint im Titel von wesentlich mehr Büchern, als sich mit Hitler beschäftigen: er ist ein Verkaufszugpferd, auch weiterhin. Zwar sagen alle immer gerne, dass sie "genug von Hitler" hätten, aber Angebot und Nachfrage sprechen eine andere Sprache.
Hoch öffentlich sind auch Filme, Dokus und Serien, die Wulf Kansteiner in Kapitel 23, "Mitlaufen, Zuschauen, Mitfühlen. Holocaust-Erinnerung im Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland", untersucht. Er arbeitet heraus, wie wenig die Figur des Mitläufers in solchen Produkten auftaucht, weil wir stattdessen vor allem Bösewichter und Widerstandshelden sehen. Er untersucht zudem mehrere Phasen der Filmproduktion zum Holocaust, die zuerst von Entschuldigungen und Erinnerungen an deutsches Leid, dann von Emotionalisierung, in den 1990er Jahren dann von einer Konzentration auf deutsche Opfer und neuerdings von einem kritischeren Ansatz begleitet seien.
Vertieft mit filmischen Auseinandersetzungen zum Holocaust befasst sich Sonja M. Schultz in Kapitel 24, "Kino und Katharsis? Bilder vom Nationalsozialismus im deutschen Film". Sie geht in ihrem Beitrag von den Kinobeiträgen der 1950er Jahre, in denen ein großer Boom von Weltkriegskitsch aufkam (man denke an den "Arzt von Stalingrad") zu zunehmend kritischeren Beiträgen hin zur Serie "Holocaust" (an der man bei diesen Betrachtungen nie vorbeikommt) zu Guidos Knopp Betroffenheits- und Gutfühlkitsch, den grausigen ÖRR-Produktionen (ich nenne sie immer Artikel+Substantiv-Filme). Sie bezieht auch das internationale Kino ein, sowohl Filme aus dem Ostblock (die im Westen meist wenig rezipiert wurden), aber auch Werke wie "Schindlers Liste" oder "The Grey Zone". Insgesamt schafft sie damit einen guten Überblick, der natürlich auf Kosten der Tiefe bei den einzelnen Werken geht, die nur angerissen werden können.
Wesentlich tiefer geht hier Patrick Merziger Kapitel 25, ""Um des Lachens willen sind die Kinos voll." Zur Verarbeitung deutscher Vergangenheit in der Filkomödie "Wir Wunderkinder" (1958)", der den (mir vorher ehrlich gesagt unbekannten) Film "Wir Wunderkinder" von 1958 bespricht. Die Verfilmung einer (wesentlich problematischeren) Buchvorlage erlangte zur damaligen Zeit viel Lob und auch großen internationalen Erfolg, überraschenderweise in Ost wie West. Das liegt wohl auch an der Ambivalenz des Films, der sich einer eindeutigen Interpretation verschließt und sowohl sehr selbstkritisch als auch selbstbestätigend gelesen werden kann. Für meinen Geschmack war der Beitrag Merzigers schon fast zu detailliert, aber das sagt natürlich weniger über seine Qualität als meine Präferenzen aus.
Abschnitt 8, "Raubkunst und Restitution", befasst sich mit dem Umgang der Restitution geraubter Kunstgüter.
Hierfür unternimmt Johannes Gramlich in Kapitel 26, "NS-Raubkunst und die Herausforderung der Restitution", vor allem eine fachliche Einordnung und stellt fest, was unter dem Begriff eigentlich verstanden wird. Konkret wendet er sich gegen den Begriff der "Raubkunst", weil dieser die vielen Dimensionen des Problems mehr verschleiere als erhelle, da von direktem Raub zu forcierten Ankäufen bis zu scheinlegalen Geschäften ein großes Spektrum geboten wird, das entsprechend auch die Restitution deutlich erschwert. Historisch zeigt Gramlich auf, wie die Nazis die Juden entrechteten und eine spezifische Bürokratie Stück für Stück enteigneten, auch indirekt über Auswanderungssteuern. Das so geschaffene Überwachungsnetz, das auch massiv auf Denunziation basierte, ermöglichte eine präzise Feststellung jüdischen Vermögens. In den späteren Expansionen des Regimes ging diese Bürokratie dann viel ungehemmter und direkter vor; in Osteuropa wurde zudem auch aller staatlicher und privater, nicht "nur" jüdischer, ausgeplündert. Die Restitution nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von den Alliierten von Anfang an betrieben, im Osten allerdings nur auf staatlicher Ebene. Schwieriger blieb die innerdeutsche Restitution, die zudem (ein Leitmotiv) von den Behörden absichtlich hintertrieben wurde, um möglichst schnell einen "Schlussstrich" zu erreichen. Die Wende in der Aufarbeitung der NS-Zeit in den 1990er Jahren führte dann zu einer neuen Restitutionswelle, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist.
Andrea Bambi befasst sich in Kapitel 27, "Kunstraub, Restitutionsfragen und Provenienzforschung. Historische Perspektiven einer verzögerten Aufarbeitung", vertiefter mit der Metaebene dieser Restitutionswelle, indem sie aufzeigt, wie die Forschung vorging und vorgeht, welche Desiderate bestehen und in welchen Datenbanken die entsprechenden Informationen sind. Angesichts dessen, dass in 255 Museen rund 21 Millionen Fundstücke lagern, die jeweils Monate der Recherche benötigen und es insgesamt kaum 30 Forschungsstellen gibt, ist hier noch auf lange Zeit Forschungsarbeit zu leisten. Die öffentliche Wahrnehmung unterliege währenddessen einem ständigen Wandel, den Bambi an einigen Beispielen deutlich macht.
Abschnitt 9, "Kontroversen vor der Gegenwart", befasst sich schließlich mit aktuellen Diskussionen.
Bill Niven stellt in Kapitel 28, "Jüngere Strömungen deutscher Erinnerungskultur - einige Beobachtungen", einige Thesen zu aktuellen Diskussionen in der Debatte auf. So postuliert er, dass wir uns in einer "post-moralistischen" Phase der Erinnerung befänden, die davon gekennzeichnet sei, dass zunehmend dezentral und weniger von klaren Aufklärungsgesten geprägt erinnert werde; besonders die Stolpersteine hebt Niven hier positiv heraus und grenzt sie vom seiner Ansicht nach bereits beim Bau "überholten" Holocaust-Mahnmal in Berlin ab. Niven lässt eine generelle Zuneigung zu solchen Diskursen erkennen, die eher in dem Sinne revisionistisch sind, als dass sie frühere deutsche Schulddebatten komplett ausblenden. So lobt er etwa "Unsere Mütter, unsere Väter" dafür, dass polnischer Antisemitismus so unbefangen kritisiert werde, während gleichzeitig Auschwitz keine Rolle spiele. Ich konnte mit seinen Thesen eher wenig anfangen, auch wenn ich ihnen zu Teilen durchaus zustimmen kann.
Abschnitt 10, "Kleinkunst und Literatur: Zwei Interviews", stellt dann zwei von Markus Brechtken geführte Interviews an den Abschluss des Bandes.
Das erste Interview mit Thomas Pigor, Kabarettist und Stimme Hitlers in Walter Moers "Bonker", in Kapitel 29, ""...eine geradezu blasphemische Freude, dem Moloch ans Bein zu pinkeln..."", lässt Pigor seine Herangehensweise an eine kabarettistische Verwertung Hitlers reflektieren. Wenig überraschend äußert er sich positiv und sieht in der ironischen Brechung eine wertvolle Perspektive; zudem betrachten Pigor und Brechtken die Geschichte kabarettistischer Verwertung und die Kontextabhängigkeit solcher Scherze.
Das zweite Interview mit Timur Vermes, dem Autor von "Er ist wieder da", in Kapitel 30, ""Das ist entsetzlich - und komisch."", dreht sich engmaschiger um Vermes eigenen Zugang zu Hitler. Er verteidigt seine Konzeption, aus der Ich-Perspektive einen "heutigen" Hitler abzubilden, und sieht sein 2011 erschienenes Buch im Großen und Ganzen immer noch als aktuell. Vorwürfe einer Verharmlosung weist er zurück.
---
Ich muss zugeben, ich habe mich lange vor dem Band gedrückt. Er lag prominent auf meinem Stapel der Schande, aber die Frage, ob ich wirklich 680 eng bedruckte Seiten zur NS-Aufarbeitung lesen will, kam dann noch immer mit einem entschlossenen "eh, vielleicht später" zurück. Brechtkens Einleitung mit ihrer Kritik an Relativierung reizte mich dann auch direkt zum Widerspruch, weil sie mir andere Perspektiven etwas zu schnell auszuschließen und den potenziellen Diskurskorridor zu stark zu verengen schien. Die Auswahl der Autor*innen und der Beiträge zeigt das natürlich auch ein wenig auf; gleichzeitig kann man Brechtken kaum vorwerfen, dass hier ein einseitige Präsentation passieren würde. Aber Diskurse wie Zimmerers Kolonialisierungs-These oder die Katechismusdebatte werden wenn überhaupt nur kritisch aus der Außenperspektive gestreift und finden keinen Eingang in den Band; Brechtken et al stellen sie ziemlich klar außerhalb des satisfaktionsfähigen Konsens'. Ich bin kein Forscher mit einem Schwerpunkt im Gebiet, weswegen ich mir eine Bewertung hier verbiete, es fiel mir nur auf.
Ein Begriff, den ich erst durch Bauernkämpfers Beitrag lernte und sehr schätze, ist "Sühnestolz". Er beschreibt gut das Spannungsfeld, in dem die deutsche Vergangenheitspolitik sich bewegt und mit dem sich ja einige der Autor*innen hier auseinandersetzen. Auf der einen Seite ist und bleibt die deutsche Vergangenheitspolitik in meinen Augen die beste weltweit, worauf man zurecht stolz sein kann; gleichzeitig hat sie natürlich ihre blinden Flecken und neigt dazu, kategorisch bestimmte Sichtweisen vorzugeben und manchmal auch selbstgefällig zu befinden, dass man alles richtig gemacht habe. Gleichzeitig aber tun wir es trotz aller Defizite. Für mich ist der Begriff deswegen nicht ganz so negativ besetzt wie für Bauernkämpfer.
Eine Emotion, die vor allem in den frühen Kapiteln des Bandes immer wieder in mir hochkam, ist Wut. Ich wusste natürlich schon vorher, dass die Vergangenheitsaufbearbeitung ein vergleichsweise zeitgenössisches Phänomen ist und vor allem in der Adenauer-Ära ein...anderes Verhältnis zur NS-Vergangenheit herrschte. Es macht mich aber immer noch jedes Mal wütend, wie man lange die Verantwortung geleugnet hat und wie gezielt einerseits klaren Tätern geholfen wurde, sich reinzuwaschen, und zu allem Überfluss auch noch auf die Opfer eingeschlagen wurde. Das ist wahrlich kein Ruhmesblatt der Republik.
Eine Frage, die viele der Kapitel für mich immer aber trotzdem immer wieder aufwarfen: War der Schlussstrich richtig? Denn letztlich ist schwer vorstellbar, dass eine Aufarbeitung, wie wir sie seit den 1990er Jahren betreiben, überhaupt möglich gewesen wäre, solange die ganzen Täter*innen nicht schon überwiegend tot oder doch wenigstens der Entscheidungssphäre entzogen waren. Die Deutschen hatten sich so umfassend schuldig gemacht, dass eine solche Aufarbeitung wahrscheinlich einem kalten Bürgerkrieg gleichgekommen wäre. Ich bin, quasi als vorläufige Arbeitshypothese, weil die Frage im Buch nicht gestellt wird, bei folgender Überlegung: ein grundsätzlicher Schlussstrich war unvermeidbar, allerdings ging die junge BRD an einigen Stellen wesentlich zu weit und deutlich über das notwendige Maß hinaus. Dieser Schlussstrich auf allen Ebenen entsprach einer Entrechtung der Opfer. Die BRD erreichte damit bei ihnen genau den Effekt, den sie bei den Täter*innen zu vermeiden suchte; wahrlich kein Ruhmesblatt.
Das zeigt sich auch im direkten Vergleich mit der DDR. Nicht, dass die eine mustergültige Politik betrieben hätten, aber sie waren zumindest an einigen Stellen entschlossener und konsequenter als die BRD. Die in den entsprechenden Beiträgen aufgeworfene Frage, ob dies zu institutionellen Dysfunktionalitäten signifikanten Ausmaßes geführt hat, wäre wirklich eine, die in meinen Augen dringend beantwortet und beforscht werden sollte. Generell ist der starke Fokus auf die BRD noch eine Schwäche des Bandes, der aber auch dem Forschungsstand geschuldet ist: die Forschung am Umgang mit der NS-Vergangenheit in der DDR steckt ja noch in ihren Kinderschuhen, da ist viel komparative Arbeit zu leisten, was uns eventuell für die Zukunft und den weiteren Umgang neue Erkenntnisse an die Hand geben kann.
Da in Baden-Württemberg zur Zeit die Lektüre von Katharina Hackers Roman "Die Habenichtse" verpflichtender Abiturstoff ist, der sich unter anderem um Restitutionsansprüche der Nachkommen jüdischer Opfer und die damit verbundenen Gerechtigkeitsfragen dreht, habe ich die Kapitel zur Restitution mit einer großen Neugierde gelesen. Ich finde es faszinierend, wie hier mit der kleinteiligen Logik des Rechtsstaats Stück für Stück Gerechtigkeit zu schaffen versucht wird und wie unbefriedigend und unvollständig diese Versuche zwangsläufig bleiben müssen - und wie wichtig sie dennoch sind.
Insgesamt war die Lektüre des Bands für mich sehr lohnenswert. Wer sich für die Materie interessiert, wird in diesem Kompendium sicherlich eine gute Übersicht finden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen