Timothy Rilback - Takeover. Hitler's final rise to power (Hörbuch)
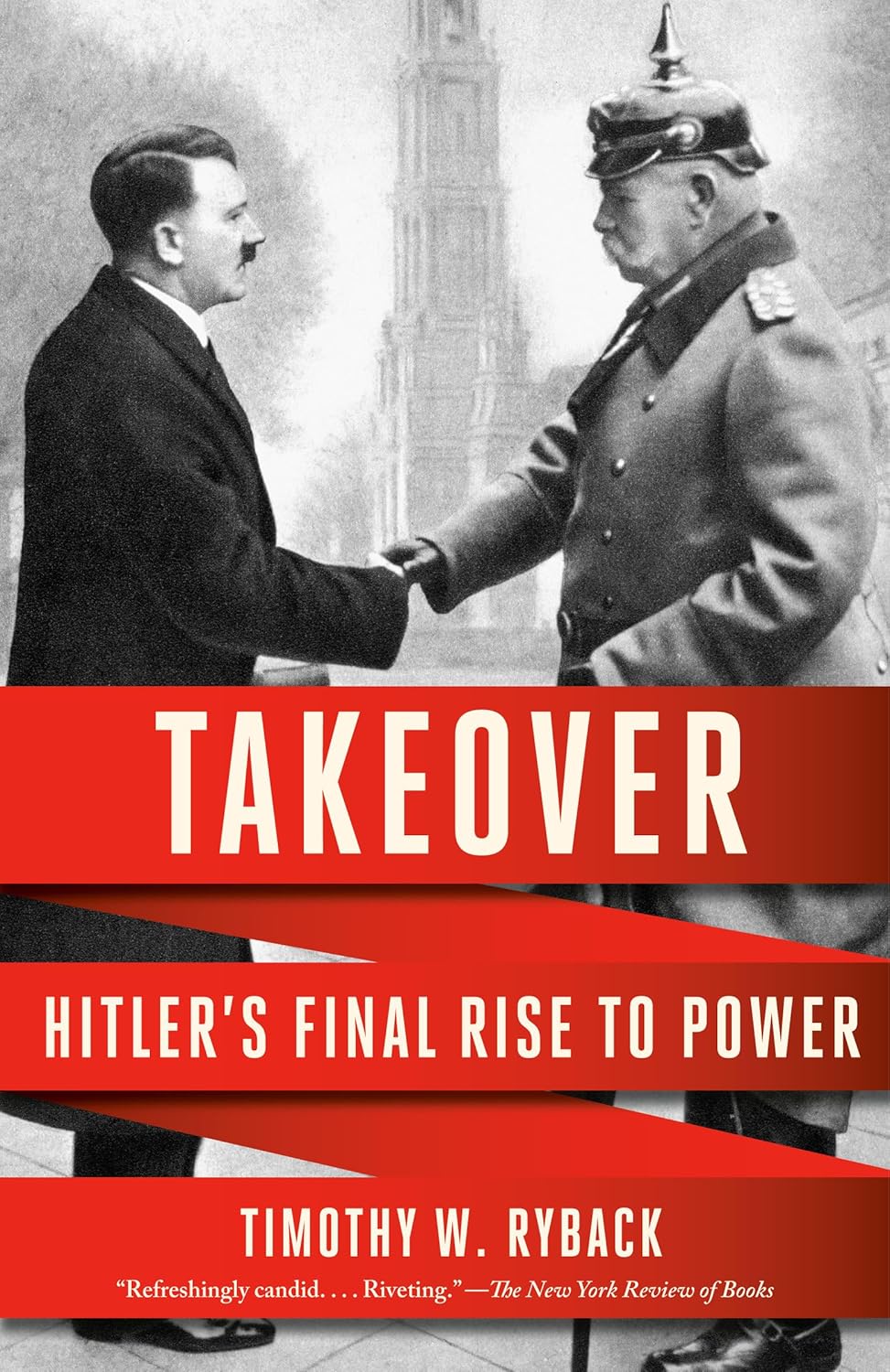 Der Aufstieg Hitlers an die Machtstellung eines absoluten Diktators Deutschland und das damit einhergehende Ende der Weimarer Republik haben die Gemüter der Menschen seitdem sie passiert sind bewegt. Wie gelang es diesem Mann, gegen so viele Widerstände an die Macht zu kommen und die Demokratie zu zerstören? Und was können wir daraus lernen? Der aktuelle Umbau der USA von einer liberalen Demokratie zu einer wenigstens illiberalen, wenn nicht gar zu einem autoritären Staat hat für einen Aufschwung in der Beschäftigung mit dem Ende der Weimarer Republik gesorgt, die entsprechenden Büchern wesentlich mehr Aufmerksamkeit bringt, als sie das noch vor einigen Jahren getan hätte. Ein aktueller Eintrag in diese Liste ist Timothy W. Rybacks "Takeover", das wohlwollende Rezensionen erhielt und zu einem kleinen Publikumshit wurde. Ich habe Rybacks Schilderung der Geschehnisse zwischen dem Sommer 1932 und der Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933 gelesen.
Der Aufstieg Hitlers an die Machtstellung eines absoluten Diktators Deutschland und das damit einhergehende Ende der Weimarer Republik haben die Gemüter der Menschen seitdem sie passiert sind bewegt. Wie gelang es diesem Mann, gegen so viele Widerstände an die Macht zu kommen und die Demokratie zu zerstören? Und was können wir daraus lernen? Der aktuelle Umbau der USA von einer liberalen Demokratie zu einer wenigstens illiberalen, wenn nicht gar zu einem autoritären Staat hat für einen Aufschwung in der Beschäftigung mit dem Ende der Weimarer Republik gesorgt, die entsprechenden Büchern wesentlich mehr Aufmerksamkeit bringt, als sie das noch vor einigen Jahren getan hätte. Ein aktueller Eintrag in diese Liste ist Timothy W. Rybacks "Takeover", das wohlwollende Rezensionen erhielt und zu einem kleinen Publikumshit wurde. Ich habe Rybacks Schilderung der Geschehnisse zwischen dem Sommer 1932 und der Machtübergabe an Hitler am 30. Januar 1933 gelesen.
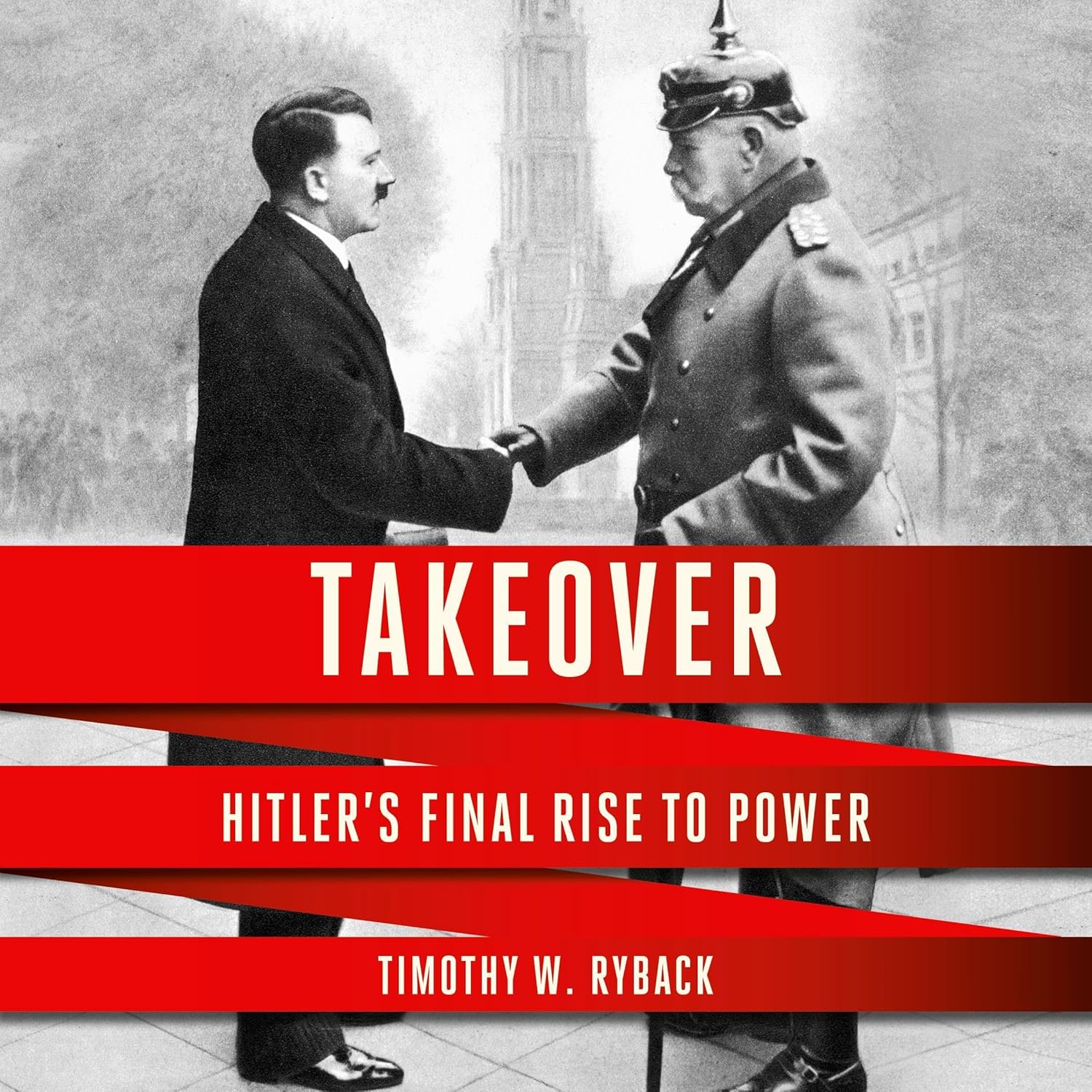 Ryback skizziert in Kapitel 1, "Stargazing", die nationalsozialistische Führungsriege mit ihren Wunschvorstellungen in Hitlers Alpenrückzugsort in Berchtesgaden. Die Situation schien so günstig wie nie zuvor: Deutschland in einer Dauerkrise, jede Wahl größere Erfolge und nun die unpopulärste Regierung aller Zeiten an der Macht: der takeover schien greifbar nahe. Das lag auch an den in Kapitel 2, "Victims of Democracy", beschriebenen Enttäuschten. Vor allem in den verlorenen Ostgebieten und der polnischen Grenzregion gab es eine Sehnsucht nach autoritärer Führung und eine breite Ablehnung der Versailler Friedensordnung, die unauflösbar mit der sie durchsetzenden Weimarer Republik verknüpft war.
Ryback skizziert in Kapitel 1, "Stargazing", die nationalsozialistische Führungsriege mit ihren Wunschvorstellungen in Hitlers Alpenrückzugsort in Berchtesgaden. Die Situation schien so günstig wie nie zuvor: Deutschland in einer Dauerkrise, jede Wahl größere Erfolge und nun die unpopulärste Regierung aller Zeiten an der Macht: der takeover schien greifbar nahe. Das lag auch an den in Kapitel 2, "Victims of Democracy", beschriebenen Enttäuschten. Vor allem in den verlorenen Ostgebieten und der polnischen Grenzregion gab es eine Sehnsucht nach autoritärer Führung und eine breite Ablehnung der Versailler Friedensordnung, die unauflösbar mit der sie durchsetzenden Weimarer Republik verknüpft war.
Kapitel 3, "Tranquility", beschäftigt sich mit der Hindenburg-Präsidentschaft. Der Präsident bewegte sich in deutlich rechtskonservativen Kreisen, in denen die alten Regeln des 19. Jahrhunderts noch galten. So versuchte Hindenburg, den Anschein allzu offensichtlicher Machenschaften zu vermeiden und ließ sich das Gut Neudeck von reichen Gönnern schenken, anstatt direkt Korruptionsgelder anzunehmen. Seine Wahlkampagne 1932 basierte auf Ideen von Ordnung und Stabilität und stand, anders als die 1925, ganz im Schatten der rechtsextremen Konkurrenz durch Hitler, so dass er ironischerweise ein Kandidat der Republik selbst wurde - was ihm nie ganz behagte. Kapitel 4, "The Hitler Gambit", erklärt Hitlers auf die verfehlte Präsidentschaftswahl folgendes Kalkül, die Macht legal zu übernehmen. Hauptsächlich aber beschäftigt sich Ryback hier mit den Skandalstories um Hitler, vor allem sein mögliches Liebesleben mit Eva Braun und den Gossip, den Goebbels verbreitete.
Kapitel 5, "Saturday the Thirteenth", behandelt die Reichspräsidentenwahl 1932. Sie bildete Hitlers ersten Versuch, die absolute Macht im Staat zu erreichen. Den Versuch der Rechtsradikalen im Parlament, die Amtszeit Hindenburgs um zwei Jahre zu verlängern, weil er niemals eine weitere Amtszeit würde bestehen können, blockierte Hitler in dem Kalkül, dass Hindenburg sich nicht für eine volle Amtszeit zur Verfügung stellen und er gegen ein zersplittertes Bewerberfeld gewinnen könnte. Das scheiterte; Hindenburg besiegte Hitler spielend, dem damit nur die Kanzlerschaft blieb. Auf diese erhob Hitler Anspruch, weil er, nach den Reichstagswahlen im Juni ohnehin, den größten Stimmenanteil im Reichstag besaß. Kapitel 6, "Majority Rules", zeigt den vergeblichen Versuch Hitlers, aus dieser Stimmenpluralität Kapital zu schlagen. Zwar konnte er den Anspruch auf das Kanzleramt durchaus erheben, aber da ihm eine absolute Mehrheit fehlte, war er von Koalitionen abhängig - in die niemand mit ihm gehen wollte und die er selbst auch ablehnte. Hitler versteigerte sich in die Argumentation, er besitze in Wahrheit eine Mehrheit von 75%, weil er mit 37% der Reichstagsabgeordneten ja 75% von 51% besäße, weswegen ihm die diktatorische Macht zustehe.
Kapitel 7, "Boys of Beuthen", beschreibt die eigentlichen Gewalttäter näher. 1932 drangen SA-Leute in das Haus polnischstämmiger Kommunisten ein und ermordeten einen von ihnen vor den Augen seiner Mutter und seines Bruders. Besonders zurückhaltend gingen sie dabei nicht vor, weil sie offensichtlich keine großen Konsequenzen fürchteten. Doch hatten sie das Pech, den Mord kurz nach Mitternacht zu verüben. Denn wie in Kapitel 8, "Deterrent Effect", genauer ausgeführt wird, trat um Mitternacht ein neues Gesetz in Kraft, das politische Morde unter Todesstrafe stellte - und die Mörder von Beuthen wären die ersten gewesen, die darunter verurteilt hätten werden sollen. Letztlich sollte es durch Hitlers Machtübernahme dazu nicht kommen, und das Urteil wurde von Hindenburg bereits vorher in eine lebenslange Haft umgewandelt, aber es wurde deutlich, dass der Staat durchaus Mittel hatte, der Nazi-Gewalt entgegenzutreten.
Kapitel 9, "Arsenal of Democracy", erläutert die Strategie der Nationalsozialisten, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu beseitigen. Der Schwur Hitlers, anders als 1923 nur mit legalen Mitteln an die Macht zu kommen, erforderte eine Pervertierung genau jener Demokratie. Mit absichtlicher Obstruktionspolitik, einer Ausnutzung von Immunitäten und Förderungen und natürlich der liberalen Meinungsfreiheit zerstörten sie genau jenen Staat, der ihr Wirken überhaupt garantierte. Dabei halt ihnen das in Kapitel 10, "Empire of Lies", behandelte Medienimperium Alfred Hugenbergs. Der Medienmogul hatte die Fake News zum Leitprinzip seines Imperiums erklärt, und rund 1200 Zeitungen machten jeden Schwenk ihres Herausgebers mit und "fluteten die Zone mit Scheiße", wie das rund hundert Jahre später ein anderer Rechtsextremist ausdrücken würde. In Gebieten unter Hugenbergs medialem Einfluss wurde es zunehmend unmöglich, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden - was vor allem der NSDAP und immer weniger Hugenbergs DNVP diente.
Die Wahlkämpfe und Beeinflussung der Öffentlichkeit kosteten eine Menge Geld, was das Thema von Kapitel 11, "Golden Rain", ist. Die Versuche der Rechtskonservativen, Hitler und die NSDAP in ihre Regierung einzubinden, normalisierten diese und machten sie für immer breitere Unterstützerkreise satisfaktionsfähig. Wurde Hitler in Wirtschaftskreisen anfangs fast nur von Thyssen signifikant unterstützt, gaben nun immer mehr Großindustrielle Geld an die Nazipartei, wenngleich sie beständig misstrauisch gegenüber ihrem sozialistischen Flügel blieben. Kapitel 12, "Triumph of the Shrill", behandelt dann die Propaganda der Nazis, mit denen diese in jenen letzten Herbsttagen die Republik bombardierten. Die Nazis beherrschten die Kunst der Zuspitzung wie kaum jemand anderes und verstanden es, alles auf das absolute Extrem zu bringen und einen ungeheuren politischen Krach zu entfachen.
Die Außenwahrnehmung Hitlers in jenen Tagen war, wie in Kapitel 13, "Hare Hitler", aufgezeigt wird, die eines von anderen Kräften getriebenen. Er wurde als Hase ("hare") wahrgenommen, eine Art Papiertiger, die bald zugunsten Gregor Strassers weichen oder gar den Untergang der Bewegung sehen würde. Kapitel 14, "Clueless", zeigt Strassers Fähigkeiten als Koalitionsschmied. Es blieb aber immer in der Schwebe, ob die Deals, die Strasser und Schleicher überlegten - und über die sich die Hauptstadtpresse wild spekulierend das Maul zerriss - überhaupt irgendeine Basis hatten, weil stets die Frage war, ob Hitler zustimmen würde oder ob eine eventuelle Ablehnung durch Hitler noch relevant sein oder ob Strasser die Macht in der Partei übernehmen würde.
Gregor Strasser spielt auch in Kapitel 15, "Betrayal", die Hauptrolle. Zusammen mit Schleicher versuchte er, doch noch die Regierungsbeteiligung zu erreichen, indem er einen Teil der NSDAP-Abgeordneten auf dem Weg der Parteispaltung mit in eine breite Koalition nehmen würde. Hitler allerdings manövrierte ihn aus und versammelte die Partei durch uncharakteristisch leise und selbstkritische Beziehungsarbeit hinter sich. Strasser war isoliert - und Schleicher damit am Ende. In Kapitel 16, "Ghosts of Christmas Present", gleitet das Geschehen ins Farcehafte ab. Während Gregor Strasser sich selbst in einem Italienurlaub aus dem Spiel nimmt, versuchen Akteure wie von Papen noch immer, im luftleeren Raum irgendwelche Intrigen zu spinnen, die Regeln der politischen Schwerkraft doch außer Kraft zu setzen. Gleichzeitig sind zahlreiche Beobachtende überzeugt, dass Hitler sich verpokert haben müsste, dass die Wahlen vom November die Schwäche der Nazis offengelegt hätten.
Der letzte Wahlkampf der Weimarer Republik ist Thema von Kapitel 17, "Hitler in Lipperland". Das kleine Detmold-Lippe sah eine geradezu absurde Investition aller Parteien, vor allem aber der NSDAP, um ein möglichst vorzeigbares Ergebnis als Argument für oder gegen die Regierungsbeteiligung der NSDAP präsentieren zu können. Das Ergebnis war uneindeutig: die NSDAP verlor zwar, aber nur leicht, während die DNVP massiv einbüßte und Hugenbergs Position deutlich schwächte. Der Fallout dieser Entwicklungen spielt die Hauptrolle von Kapitel 18, "The Strasser Calibration". Das politische Berlin war voller Spekulationen über die Zukunft Strassers, die sich natürlich alle nicht materialisierten. In der Abwesenheit belastbarer Fakten und in einer Medienlandschaft, die es mit objektiver Berichterstattung nicht sonderlich ernst nahm, grassierten die Gerüchte.
Die eigentlichen Geschehnisse fanden, wie Kapitel 19, "Visitations", hinter verschlossenen Türen statt. Geheimtreffen über Geheimtreffen fanden in der Kamarilla um Hindenburgs Berater statt, die die Gerüchteküche einerseits anfeuerten und andererseits in der Gemengelage der Gerüchte selbst mit unvollständigen Informationen operierten. Diese Besuche stellten auch das Zwielicht von Schleichers Karriere als Kanzler dar, der rapide an Einfluss verlor. Die in Kapitel 20, "Hindenburg Whisperers", genauer vorgestellten Akteure hofften alle auf ihre Art, in den rapide wechselnden politischen Machtverhältnissen um Hindenburg die Oberhand zu behalten. In der für Kapitel 21, "Fateful Week", titelgebenden Woche spitzen sich die Ereignisse dann zu. Unter der Anleitung von Papens und Oskar von Hindenburg fand sich der Reichspräsident schließlich doch bereit, Hitler als Kanzler zu akzeptieren. Von Papens Fehleinschätzung, dass man ihn bald "in der Ecke haben werde, bis er quietscht" reiht sich in die strategischen Fehler der ganzen nationalistischen Herrenriege ein.
Hugenberg wenigstens war so hellsichtig, den Fehler noch am Tag der Machtübergabe zu erkennen, wie Kapitel 22, "January 30, 1933", neben anderen Anekdoten einer insgesamt reichlich lieblosen Amtseinführung demonstriert. Noch bei der Vereidigung drohte das Bündnis der rechtsextremen Diven zu platzen, weil Hugenberg nicht bereit war, Neuwahlen zu akzeptieren (und sie dann doch schlucken musste, weil er sich verkalkuliert hatte). Der Marsch der SA im Fackelschein durch die Straßen war der unwürdige Schlussstein einer unwürdigen Saga. Das letzte Kapitel, "Postscripts", skizziert die weiteren Lebenswege der Akteure: Hindenburgs Tod, Schleichers und Strassers Ermordung, Hugenbergs Isolation oder von Papens Abschieben auf den Botschafterposten in der Türkei.
---
Das Ende der Weimarer Republik fasziniert viele Leute, in diesen Tagen umso mehr. Der ewigen Frage, was denn nun eigentlich zu ihrem Untergang führte, kann ich mich selbst auch nicht entziehen. Nach meinem Dafürhalten leidet die Beschäftigung mit dem Thema stark unter einem teleologischen Einschlag; es ist schwer, diese Geschichte ohne ihren unvermeidlichen Endpunkt zu erzählen. Jedoch, gerade das ist notwendig, will man tatsächlich Erkenntnisse gewinnen und Hitlers Weg zur Macht nicht als eine Naturkonstante betrachten, die letztlich unvermeidlich war, als ob Wirtschaftskrise, Elitenversagen, Ressentiments und so weiter kein anderes Ende als die Diktatur, den Vernichtungskrieg und den Holocaust gekannt hätten.
Wer aber mit solcherlei Hoffnungen in die Lektüre startet, wird enttäuscht. Ryback bietet keinerlei Deutungen oder Analysen, sein Ansatz ist ein rein reproduktiver. Das kann seinen Reiz haben; Rüdiger Barth und Hauke Friedrichs haben mit "Die Totengräber" (hier rezensiert) vor einigen Jahren einen interessanten Ansatz dafür vorgelegt. Leider gelingt Ryback dies nicht so gut. Wie die "Totengräber" auch liest sich seine Darstellung der Machtübernahme trotz des bekannten Endes spannend; die Geschehnisse geben immer wieder einen guten Politthriller ab, und Ryback schreibt flott und eingängig, ohne die Lesenden zu überfordern.
Leider bietet er, anders als es noch die "Totengräber" taten, auch nichts Neues. Teilweise ist das sicherlich damit zu entschuldigen, dass er für ein US-Publikum schreibt, aber auch in Deutschland kann nicht vorausgesetzt werden, dass allzu viele Leute Strasser und Schleicher kennen. Enervierend finde ich vor allem die Quellenbasis. Wenn ich noch einmal ein Buch zu dieser Zeit lesen muss, das als Hauptquellen Goebbels' und Harry Graf Kesslers Tagebücher nutzt, schreie ich glaube ich. Das sind so niedrig hängende Früchte, die mittlerweile auch so ausgewalzt sind (noch dazu in den hagiografischen Darstellungen Kesslers in den "Geschichte Deutschlands"-Dokudramen), dass ihr Gewinn gegen null geht.
Dazu kommt, dass wo für Barth und Friedrichs der Wahnsinn Methode hatte und sie den neutralen Blick wahrten, der die Quellen für sich selbst sprechen ließ, erzählt Ryback zu sehr eine Geschichte, erliegt er zu sehr der finsteren Faszination der Nazis und der Tragik des ultimativen Endes. Noch dazu neigt Ryback dazu, die Quellen unkritisch zu übernehmen. So weist Ryback darauf hin, dass in diesen Tagen die Frage nach der geistigen Gesundheit Hindenburgs oftmals aufgeworfen wurde und verweist dazu auf Beiträge aus dem "Vorwärts", um diese dann dadurch zu entkräften, dass er Hindenburgs rechte Hand Meissner dem Reichspräsidenten einwandfreie Gesundheit attestieren lässt. Das ist, als würde man den Aussagen von Trumps Leibarzt vertrauen. Die Gegenüberstellung dieser Quellen, ihre Kontextsetzung wie Ryback sie vornimmt, implizieren zumindest eine Übernahme von Meissners Positionen. Das ist im besten Fall ein schlecht geschriebener Text, im schlimmsten Fall einfach geschichtswissenschaftlicher Kunstfehler.
So war die Lektüre des Buches zwar insgesamt unterhaltsam und in ihrer Gesamtlänge auch erträglich, bleibt aber ultimativ historisches Fastfood: leere Kalorien, an deren Ende man nicht wirklich etwas gelernt hat, weil Ryback nichts zu irgendetwas sagt, sondern uns einfach nur einen schauerlichen Politthriller präsentiert. Ist es nicht schrecklich, wie die Demokratie endete? Wäre es nicht gut, wenn man etwas dagegen getan hätte? Nur was? Und warum? Das Buch schweigt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen